Optische Telegraphenstationen im
Saarland
 Im
Jahre 1813
verlief eine Telegraphenlinie des
napoleonischen Reiches auch durch das Gebiet des Saarlandes.
Telegraphenstationen befanden sich u.a. in Lebach-Eidenborn auf dem
Hoxberg
sowie auf dem Litermont bei Nalbach. Am 20. Juli 2003 begann der Verein
"Optische
Telegrafenstation Litermont
e.V." damit, die Station auf dem Litermont wieder aufzubauen. (siehe
Foto links; Foto: W. Steffen).
Im
Jahre 1813
verlief eine Telegraphenlinie des
napoleonischen Reiches auch durch das Gebiet des Saarlandes.
Telegraphenstationen befanden sich u.a. in Lebach-Eidenborn auf dem
Hoxberg
sowie auf dem Litermont bei Nalbach. Am 20. Juli 2003 begann der Verein
"Optische
Telegrafenstation Litermont
e.V." damit, die Station auf dem Litermont wieder aufzubauen. (siehe
Foto links; Foto: W. Steffen).
Der
Turm auf dem Litermont kann nach Vereinbarung besichtigt werden.
Ansprechpartner
ist der Vorsitzende des Vereins "Optische Telegrafenstation Litermont
e.V.", Herr Bernhard Mommenthal Nalbach, Tel. 06838-92754.
1. Historischer
Hintergrund
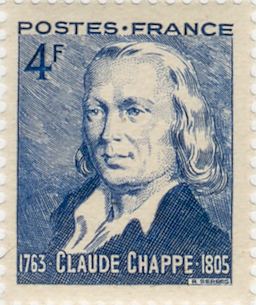 Wie kam es zu
dieser Telegraphenlinie und was hat es mit
den Stationen auf
sich? Die
Wirren der französischen Revolution im Jahre 1789 spülten Bonaparte
Napoleon
an die Macht, das linksrheinische Gebiet stand unter französischem
Einfluss.
Während der Zeit der ersten französischen Republik, also kurz nach der
Revolution, gelang es dem französischen Geistlichen und Ingenieur Claude
Chappe
(1763-1805) im Jahre 1792 nach mehrjährigen, von seinen Brüdern
unterstützten
Versuchen, brauchbare optische Telegraphen herzustellen.
Wie kam es zu
dieser Telegraphenlinie und was hat es mit
den Stationen auf
sich? Die
Wirren der französischen Revolution im Jahre 1789 spülten Bonaparte
Napoleon
an die Macht, das linksrheinische Gebiet stand unter französischem
Einfluss.
Während der Zeit der ersten französischen Republik, also kurz nach der
Revolution, gelang es dem französischen Geistlichen und Ingenieur Claude
Chappe
(1763-1805) im Jahre 1792 nach mehrjährigen, von seinen Brüdern
unterstützten
Versuchen, brauchbare optische Telegraphen herzustellen.
Ursprünglich dachte er an die Verwendung der Elektrizität zu
telegraphischen
Zwecken, jedoch schienen ihm die damaligen Probleme mit schlecht
isolierbaren
Leitungen und dem hohen Spannungsabfall entlang großer Entfernungen
unüberwindbar. Deswegen machte er sich daran, einen mechanischen
Apparat für
die Nachrichtenübermittlung zu entwickeln. Einen ersten Versuch gab es
am 2.
März 1791 im Departement Sarthe zwischen zwei 15 km voneinander
entfernt
aufgestellten Stationen in Brulon und Parce. Jedoch warf dieser Versuch
noch
einige Probleme auf; erst am 12. Juli 1793 fand der nächste Versuch
statt.
Dieser erwies sich als so erfolgreich, dass der französische
Nationalkonvent
noch am selben Tag den Aufbau einer französischen Staatstelegraphie
beschloss,
deren erste Linie schon ein Jahr später zwischen Paris und Lille
errichtet
wurde.
Nachdem
sich früh erwies,
dass diese Anlage noch einige Probleme mit zu langen und qualitativ
schlechten
Übertragungen hatte, arbeitete Chappe mit Hilfe des Mathematikers Monge
an
Verbesserungen des Systems. Es wurden verschiedene neue mechanische
Konstruktionen, größere Signalgeber und mobile Stationen für den
Einsatz bei
schlechten Sichtverhältnissen entworfen. Sein eigentlicher
Telegraph war
das Ergebnis intensiver empirischer Forschungsarbeit. Chappe hatte
genauestens
analysiert, wie verschiedene Farben zur Verbesserung der
Erkennungsleistung
beitrugen, wie die Form eines Telegraphen ausgearbeitet sein musste und
anderes
mehr.
Die
erste Telegraphenlinie (1794) erstreckte sich von Paris nach Lille, und
überbrückte die ca. 210 km mit 23 Zwischenstationen. An jeder Station
mussten
mit einem Fernrohr die beiden benachbarten Stationen ununterbrochen
beobachtet,
und die eingestellten Signale abgelesen und weitergegeben werden. Mit
der
Telegraphenlinie war es möglich, eine längere (also aus mehreren
Aussagen
zusammengesetzte) Nachricht innerhalb einer Stunde von Lille nach Paris
zu
übertragen, während die Überbringung durch berittene Boten etwa 24
Stunden
gedauert hätte. Dies sollte der französischen Regierung einen
strategischen
Vorteil bei einem befürchteten Angriff Englands erbringen. Lille liegt
etwa 50
km südöstlich von Calais, also der schmalsten Stelle des
Ärmelkanals.
Von
der Wiedereroberung von le Quesnoy durch die Franzosen am 15. August
1794 konnte
der Nationalkonvent in Paris über die Telegraphenlinie schon eine
Stunde nach
dem Einmarsch der Truppen in Kenntnis gesetzt werden. Der optische
Telegraph war
im gesamten Machtbereich Napoleons das wichtigste militärische
Nachrichtenübertragungssystem. Insgesamt wurden in Frankreich 534
ständige
Stationen über eine Strecke von ca. 5000 Kilometern eingesetzt.
Das System wurde in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts für
verschiedene
Langstreckenverbindungen eingesetzt. Die Telegraphenlinien führten u.
a. nach
San Sebastian, Toulon, Straßburg und Brest. Wie in Frankreich üblich
liefen
alle Linien in Paris zusammen. Erst die Erfindung des
elektromagnetischen
Telegraphen von MORSE ersetzte die optischen Telegraphen ab dem Jahre
1850.
2. Die Linie Metz - Mainz
Im
Jahre 1813
wurde das
Napoleon-Reich immer mehr durch eine Invasion bedroht. Napoleon
benötigte
schnelle Übertragungen, und am 13. März 1813 befahl er die
unverzügliche
Einrichtung einer Telegraphenlinie Metz - Mainz, die auch eine Station
auf dem
Hoxberg bei Lebach sowie auf dem Litermont bei Nalbach hatte. Mainz war
damals
ein wichtiger Sammel- und Truppenplatz. Abraham Chappe schaffte sehr
schnell die
provisorische Errichtung einer Linie mit 22 Stationen. Diese
funktionierte
erstmals am 22. Mai 1813.
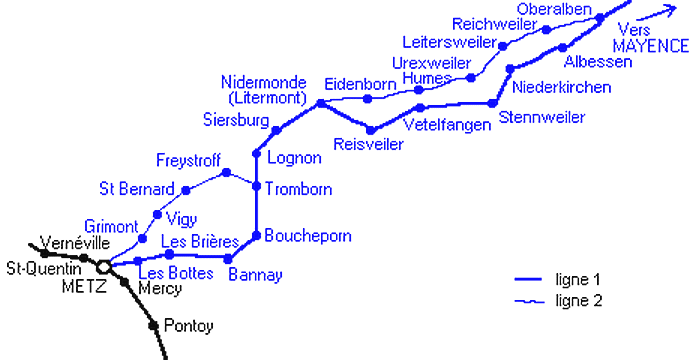
© www.telegraphe-chappe.com
Heute
geht man
davon aus, dass viele der
Telegraphenstationen nicht stationär aufgebaut waren, sondern
transportable
Einrichtungen waren. Offenbar gab es aufgrund der klimatischen und
topographischen Gegebenheiten viele Schwierigkeiten mit der
Übertragung.
Nachdem die gegnerischen Koalitionstruppen Bad Kreuznach und die
dortige Station
am 1. Januar 1814 eingenommen hatten, wurde die Linie Metz - Mainz
eingestellt.
Wegen der Kürze der Betriebsdauer gibt es keine Überreste der
Telegraphenstationen mehr.
3. Technische
Beschreibung
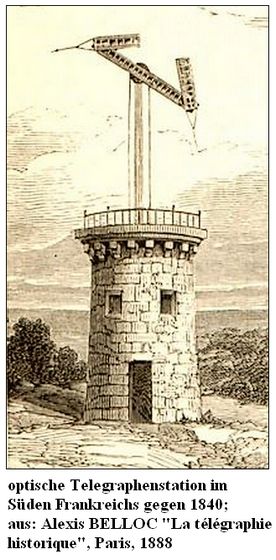 Die
Stationen dieser Telegraphenlinie bestanden meist aus einem Haus für
die aus
Soldaten bestehende Bedienungsmannschaft und einem hohen Turm, auf dem
der
Zeichengeber stand. Dieser Zeichengeber bestand aus einem auf dem
Turm errichteten Mast, auf dem sich oben ein waagerechter, beweglicher Querbalken
(Régulateur) befand. An dessen beiden Enden befand sich je ein
drehbarer Zeigerbalken
(Indicateur). Die drei beweglichen Teile konnten mit Seilen und Rollen
gesteuert
werden. Dabei ergeben sich 196 Figuren (sieben Positionen jedes Zeigers
und vier
des Querbalkens; 7 x 7 x 4 = 196).
Die
Stationen dieser Telegraphenlinie bestanden meist aus einem Haus für
die aus
Soldaten bestehende Bedienungsmannschaft und einem hohen Turm, auf dem
der
Zeichengeber stand. Dieser Zeichengeber bestand aus einem auf dem
Turm errichteten Mast, auf dem sich oben ein waagerechter, beweglicher Querbalken
(Régulateur) befand. An dessen beiden Enden befand sich je ein
drehbarer Zeigerbalken
(Indicateur). Die drei beweglichen Teile konnten mit Seilen und Rollen
gesteuert
werden. Dabei ergeben sich 196 Figuren (sieben Positionen jedes Zeigers
und vier
des Querbalkens; 7 x 7 x 4 = 196).
Das
Code-Verzeichnis wurde
streng geheim gehalten. Es gab nur wenige solcher Zeichenbücher, die
sich in
der Verwahrung von Offizieren befanden. Der Bedienungsmannschaft war
daher auch
die Bedeutung der Zeichen, die sie aufnahmen, in ein Buch zu
Kontrollzwecken
eintrugen und an die nächste Station weitergaben, nicht bekannt. Ihre
Aufgabe
war lediglich, Tag und Nacht (bei Dunkelheit wurden an den Flügeln
Fackeln
angebracht) mit einem Fernrohr nach den Nachbarstationen auszuspähen
und die
dort gezogenen Signale weiterzugeben.
Die
Nachteile
dieser optischen
Nachrichtenübertragung liegen auf der Hand: Wetterabhängigkeit, bei
Nebel konnten keine Nachrichten übertragen werden, hoher
Personalaufwand bei ständiger Beobachtung der Gegenstation und offener
Zugriff
auf Nachrichten.
4. Optische Telegraphen in
Preußen
Nachdem
die
französischen Telegraphenstationen zu
internationalem Ruhm gelangt waren, starteten auch in anderen Staaten
verstärkte
Bemühungen um nationale Telegraphenlinien. Der preußische
Generalstabsoffizier
von Oesfeld veröffentlichte 1818 eine erste Denkschrift zur optischen
Telegraphie. Die bestehende konservative Militärbürokratie erwies sich
als
hartnäckiger Hemmschuh. Als General Friedrich Carl Ferdinand Freiherr
von
Müffling (1775 - 1851) im Januar 1821 vom König zum "Chef des
Generalstabes der Armee" ernannt wurde, gewann die neue
Nachrichtentechnik
einen Fürsprecher an entscheidender Stelle. Nach vielen Vorstößen,
Kommissionen und Planspielen folgte am 21. Juli 1832 durch
"allerhöchste
Kabinettsordre" die Einrichtung einer festen Linie. Den Auftrag zum Bau
der
Telegraphenverbindung erhielt Major Franz August Etzel. Bis Juni 1833
standen
die Stationsorte fest. Beginnend bei der Berliner Sternwarte führte die
Linie
über die Dorfkirche Dahlem nach Magdeburg, über Halberstadt, Höxter und
Köln
nach Koblenz. Zwischen gut 7 und 11 km lagen die Stationen auseinander.
Neben
den üblichen neu errichteten Stationshäusern wurden auch bestehende
Bauwerke
wie Kirchen und Schlosstürme als Telegraphenstation genutzt.

preußische
Station für optische Telegraphie, um 1840
Im
Gegensatz zum
französischen Original
hatten die Maste 6 telegraphenflügeln. Die 6 Flügel konnten in 4
Positionen gebracht werden:0°,45°,90° und 135°. Dadurch ergaben sich
rein
rechnerisch 4095 verschiedene Zeichen. Es wurden so nicht nur Zahlen
und
Buchstaben dargestellt, sondern auch ganze Sätze, Wörter oder Redesätze
(z.B.
"Die Depeche ist nicht verstanden worden").
Der Betrieb der Linie wurde bis 1852 durchgeführt. Es konnte
nur immer
in eine Richtung telegraphiert werden und die Geschwindigkeit lag bei
1,5 Zeichen
pro Minute. So dauerte eine Depesche von etwa 80 Wörtern von Berlin
nach
Koblenz bei guter Sicht mehrere Stunden; jedoch war dies erheblich
schneller
(aber auch teurer), als mit einem berittenen Boten. Die Zahl der
jährlichen
Telegramme wird auf 500 geschätzt.
5. Das Ende der optischen Telegraphie
Das
Ende der
optischen Telegraphenlinie wurde durch wetterunabhängige
elektrische Telegraphie Mitte des 19. Jahrhunderts eingeläutet. Die
letzten
optischen Telegraphiestrecken wurden 1881 in Schweden außer Dienst
gestellt.
Die Stationen verschwanden aus den Landschaften und oft auch aus den
Gedächtnissen. Immerhin steht heute auf dem Hoxberg bei Lebach
wieder eine
moderne "Telegraphenstation" mit mehreren Sendeantennen für
verschiedene Mobilfunkdienste.
W. Steffen,
April 2004

Moderner
Sendemast auf dem Hoxberg, Foto: W. Steffen
Quellen:
Thies Pfeiffer: Die Entwicklung der Telegraphie,
pdf-Datei vom 8. Juni 1998,
Stadtarchiv Meschede: Die Entwicklung des
Fernmeldewesens, pdf-Datei
Karl Josef Klöhs: Königswinter Optisch-mechanische Telegraphie,
in
"Rheinkiesel, Magazin für Rhein und Siebengebirge", Oktober 2002
Links:
http://www.telegraphe-chappe.com
(sehr ausführliche Internetseiten zu Leben und Werk von Claude Chappe
in
französischer Sprache)
http://www.optischertelegraph4.de:
Die Interessengemeinschaft "Optischer
Telegraph in Preußen Station 4
Potsdam telegraphenberg" hat hier eine sehr ausführliche Darstellung
der
optischen Telegraphie in Preußen mit der Telegraphenlinie Berlin -
Koblenz erstellt.
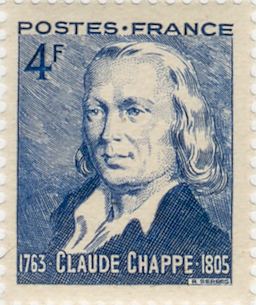 Wie kam es zu
dieser Telegraphenlinie und was hat es mit
den Stationen auf
sich? Die
Wirren der französischen Revolution im Jahre 1789 spülten Bonaparte
Napoleon
an die Macht, das linksrheinische Gebiet stand unter französischem
Einfluss.
Während der Zeit der ersten französischen Republik, also kurz nach der
Revolution, gelang es dem französischen Geistlichen und Ingenieur Claude
Chappe
(1763-1805) im Jahre 1792 nach mehrjährigen, von seinen Brüdern
unterstützten
Versuchen, brauchbare optische Telegraphen herzustellen.
Wie kam es zu
dieser Telegraphenlinie und was hat es mit
den Stationen auf
sich? Die
Wirren der französischen Revolution im Jahre 1789 spülten Bonaparte
Napoleon
an die Macht, das linksrheinische Gebiet stand unter französischem
Einfluss.
Während der Zeit der ersten französischen Republik, also kurz nach der
Revolution, gelang es dem französischen Geistlichen und Ingenieur Claude
Chappe
(1763-1805) im Jahre 1792 nach mehrjährigen, von seinen Brüdern
unterstützten
Versuchen, brauchbare optische Telegraphen herzustellen.  Im
Jahre 1813
verlief eine Telegraphenlinie des
napoleonischen Reiches auch durch das Gebiet des Saarlandes.
Telegraphenstationen befanden sich u.a. in Lebach-Eidenborn auf dem
Hoxberg
sowie auf dem Litermont bei Nalbach. Am 20. Juli 2003 begann der Verein
"Optische
Telegrafenstation Litermont
e.V." damit, die Station auf dem Litermont wieder aufzubauen. (siehe
Foto links; Foto: W. Steffen).
Im
Jahre 1813
verlief eine Telegraphenlinie des
napoleonischen Reiches auch durch das Gebiet des Saarlandes.
Telegraphenstationen befanden sich u.a. in Lebach-Eidenborn auf dem
Hoxberg
sowie auf dem Litermont bei Nalbach. Am 20. Juli 2003 begann der Verein
"Optische
Telegrafenstation Litermont
e.V." damit, die Station auf dem Litermont wieder aufzubauen. (siehe
Foto links; Foto: W. Steffen).
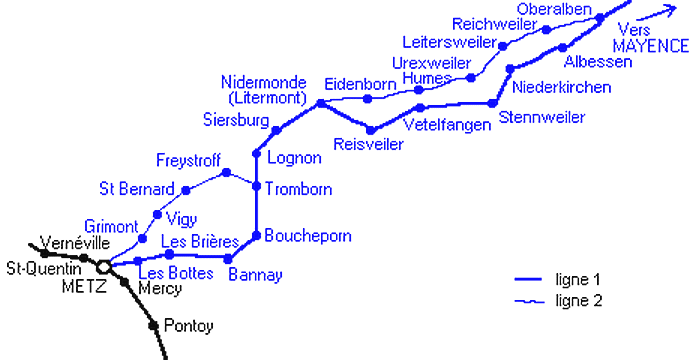
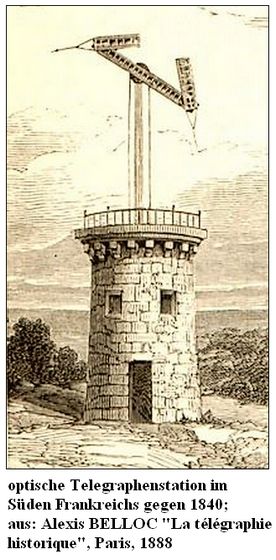 Die
Stationen dieser Telegraphenlinie bestanden meist aus einem Haus für
die aus
Soldaten bestehende Bedienungsmannschaft und einem hohen Turm, auf dem
der
Zeichengeber stand. Dieser Zeichengeber bestand aus einem auf dem
Turm errichteten Mast, auf dem sich oben ein waagerechter, beweglicher Querbalken
(Régulateur) befand. An dessen beiden Enden befand sich je ein
drehbarer Zeigerbalken
(Indicateur). Die drei beweglichen Teile konnten mit Seilen und Rollen
gesteuert
werden. Dabei ergeben sich 196 Figuren (sieben Positionen jedes Zeigers
und vier
des Querbalkens; 7 x 7 x 4 = 196).
Die
Stationen dieser Telegraphenlinie bestanden meist aus einem Haus für
die aus
Soldaten bestehende Bedienungsmannschaft und einem hohen Turm, auf dem
der
Zeichengeber stand. Dieser Zeichengeber bestand aus einem auf dem
Turm errichteten Mast, auf dem sich oben ein waagerechter, beweglicher Querbalken
(Régulateur) befand. An dessen beiden Enden befand sich je ein
drehbarer Zeigerbalken
(Indicateur). Die drei beweglichen Teile konnten mit Seilen und Rollen
gesteuert
werden. Dabei ergeben sich 196 Figuren (sieben Positionen jedes Zeigers
und vier
des Querbalkens; 7 x 7 x 4 = 196). 
